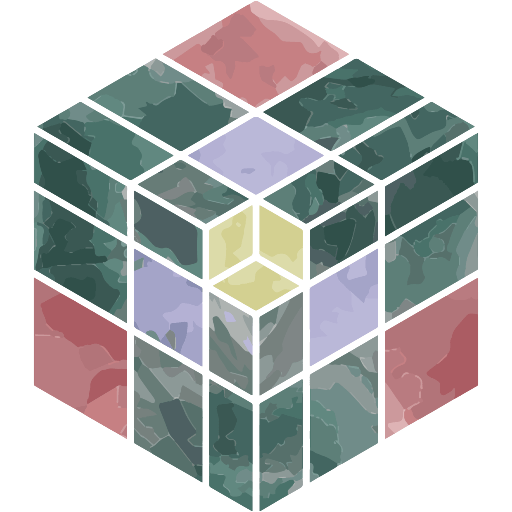Leise Gewalt bei Kindern erkennen und verstehen – Ein Blick auf subtile Formen durch die Brille der Montessori-Pädagogik
Warum es Mut braucht, sie beim Namen zu nennen
Es beginnt selten dort, wo wir es erwarten würden. Nicht mit lautem Geschrei, nicht mit Tränen, die offen fließen, nicht mit einem eindeutigen „Hier ist etwas falsch“.
Es beginnt vielmehr in diesen stillen, beiläufigen Momenten, in denen ein Blick übersehen wird, eine Geste nicht beantwortet, ein Bedürfnis übergangen, eine Grenze nicht wahrgenommen oder gar nicht erst als solche anerkannt wird, und genau deshalb ist es so schwer zu benennen, was da eigentlich geschieht …
Leise Gewalt bei Kindern erkennen und verstehen – Ein Blick auf subtile Formen durch die Brille der Montessori-Pädagogik
Warum es Mut braucht, sie beim Namen zu nennen

Es beginnt selten dort, wo wir es erwarten würden. Nicht mit lautem Geschrei, nicht mit Tränen, die offen fließen, nicht mit einem eindeutigen „Hier ist etwas falsch“.
Es beginnt vielmehr in diesen stillen, beiläufigen Momenten, in denen ein Blick übersehen wird, eine Geste nicht beantwortet, ein Bedürfnis übergangen, eine Grenze nicht wahrgenommen oder gar nicht erst als solche anerkannt wird, und genau deshalb ist es so schwer zu benennen, was da eigentlich geschieht …
Gewalt, ein Wort, das schwer auf uns lastet und oft einschüchternd wirkt.
Wenn wir daran denken, stellen wir uns vermutlich Fäuste, laute Worte, Drohungen und Angst vor. Wir sehen das Offensichtliche, das uns unmittelbar als falsch und inakzeptabel erscheint, und das wir ohne zu zögern sofort ablehnen.
Doch Gewalt ist nicht nur das, was laut und sichtbar ist.
Gewalt trägt viele Gesichter.
Manche sind laut, andere leise und kaum hörbar und verschleiern sich in alltäglichen Handlungen und Worten, die wir längst als normal und nicht hinterfragbar akzeptiert haben. Gerade weil diese leisen Formen so häufig und selbstverständlich erscheinen, sind sie oft besonders gefährlich. Sie nagen langsam und unbemerkt an der Seele, an der Würde und am Selbstwert … und doch nehmen wir sie viel zu selten bewusst wahr oder unterschätzen ihre Wirkung.

Wenn Verletzung keinen Namen hat
Was ist also, wenn wir noch nicht von Gewalt sprechen? Wenn das, was geschieht, sich nicht klar einordnen lässt, keinen lauten Bruch darstellt, keine offen sichtbare Grenze überschreitet und trotzdem schmerzt?
Was ist es, wenn ein Kind nicht beschreiben kann, was genau passiert ist, aber etwas in ihm sich verändert hat: ein Blick, ein Rückzug, ein Schweigen?
Was ist, wenn sich diese Momente wiederholen, die sich zu einem Muster verweben, das keine Worte braucht und trotzdem eine klare Botschaft sendet?
Dann stehen wir oft sprachlos davor, ringen mit Einordnung, suchen nach Begriffen und vermeiden vielleicht gerade deshalb das Wort, das eigentlich gesagt werden müsste.
Oft wird Kindern und auch Erwachsenen erst dann geglaubt, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten ist: Wenn es oft genug passiert ist, dokumentiert wurde, belegt werden kann. Doch ein Kind leidet nicht erst dann, wenn die Statistik greift.
Dann, und oft erst dann, dürfen Begriffe benutzt werden. Dann wird benannt, was längst begonnen hat zu wirken. Dann wird katalogisiert, analysiert und dokumentiert. Und ja, es ist gut und auch wichtig, dass wir Begrifflichkeiten haben, dass es Definitionen gibt. Aber das darf nicht der Moment sein, an dem wir erst beginnen hinzusehen!
Denn wer erst handelt, wenn ein Wort offiziell ausgesprochen werden darf, vergisst, dass Schutz kein Privileg ist, das Kinder erst erbitten müssen und hat das Kind längst viel zu lange allein gelassen.

Wenn Verletzung keinen Namen hat
Was ist also, wenn wir noch nicht von Gewalt sprechen? Wenn das, was geschieht, sich nicht klar einordnen lässt, keinen lauten Bruch darstellt, keine offen sichtbare Grenze überschreitet und trotzdem schmerzt?
Was ist es, wenn ein Kind nicht beschreiben kann, was genau passiert ist, aber etwas in ihm sich verändert hat: ein Blick, ein Rückzug, ein Schweigen?
Dann stehen wir oft sprachlos davor, ringen mit Einordnung, suchen nach Begriffen und vermeiden vielleicht gerade deshalb das Wort, das eigentlich gesagt werden müsste.
Was ist, wenn sich diese Momente wiederholen, die sich zu einem Muster verweben, das keine Worte braucht und trotzdem eine klare Botschaft sendet?
Oft wird Kindern und auch Erwachsenen erst dann geglaubt, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten ist: Wenn es oft genug passiert ist, dokumentiert wurde, belegt werden kann. Doch ein Kind leidet nicht erst dann, wenn die Statistik greift.
Dann, und oft erst dann, dürfen Begriffe benutzt werden. Dann wird benannt, was längst begonnen hat zu wirken. Dann wird katalogisiert, analysiert und dokumentiert. Und ja, es ist gut und auch wichtig, dass wir Begrifflichkeiten haben, dass es Definitionen gibt. Aber das darf nicht der Moment sein, an dem wir erst beginnen hinzusehen!
Denn wer erst handelt, wenn ein Wort offiziell ausgesprochen werden darf, vergisst, dass Schutz kein Privileg ist, das Kinder erst erbitten müssen und hat das Kind längst viel zu lange allein gelassen.
Über den kindlichen Verstand senkt sich eine Art Schleier herab und lässt in wachsendem Maße seelische Blindheit und Taubheit aufkommen. Bei dieser inneren Abwehr ist es als sagte die Seele im Unterbewusstein: Ich kann mir nicht meine Welt aufbauen, weil ich dabei bin, eine Schutzmauer zu errichten, damit ihr nicht hereinkommen könnt."
– Maria Montessori.
Formen von subtiler Gewalt und warum wir sie nicht kleinreden dürfen
Subtile Gewalt umfasst Verhaltensweisen und Handlungen, die auf den ersten Blick oft harmlos erscheinen oder gar nicht offensichtlich sind, sie verstecken sich oft im Alltag und in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Subtile Gewalt beinhaltet unter anderem:
- Emotionale Vernachlässigung:
Das dauerhafte Ignorieren oder Nicht-Ernstnehmen der Gefühle eines Kindes. - Grenzüberschreitungen:
Das Übergehen persönlicher Grenzen, etwa durch ungewollte Berührungen oder das Nicht-Anerkennen eines klar ausgesprochenen „Nein“. - Herabsetzung und Beschämung: Leise Formen der Demütigung, die durch spöttische Kommentare, abschätzige Blicke oder ständige Kritik erfolgen.
- Ausgrenzung und Ignorieren: Systematisches Ausschließen oder das Nicht-Beachten eines Kindes in Gruppen oder im Alltag.
- Überforderung und fehlende Unterstützung: Kinder, die dauerhaft mit Anforderungen konfrontiert werden, die sie nicht bewältigen können, ohne die notwendige Begleitung zu erhalten.
- Manipulation und Kontrolle: Verhaltensweisen, die das Kind in seiner Freiheit einschränken und es emotional unter Druck setzen.
- Rollenumkehr: Manche Kinder werden in Rollen gedrängt, die eigentlich Erwachsene ausfüllen sollten. Sie tragen Verantwortung oder Sorgen, die sie noch nicht bewältigen können.
- Sexualisierte Gewalt beginnt nicht erst bei Übergriffen!
Sie beginnt dort, wo Körpergrenzen nicht geachtet werden.
Wo ein Kind gegen seinen Willen umarmt, geküsst oder anzüglichen Kommentaren oder Blicken ausgesetzt ist. Wo Nähe und Berührung nicht freiwillig ist. - Vernachlässigung der Aufsichtspflicht heißt nicht nur, dass ein Kind allein gelassen wird. Es heißt auch: Nicht hinsehen, wenn Kinder sich gegenseitig verletzen.
Nicht reagieren, wenn ein Kind täglich ausgegrenzt oder verspottet wird.
Wegschauen, weil „das eben mal passiert“.
Oder weil „es doch nicht böse gemeint war“. - Körperliche Vernachlässigung bedeutet, dass grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Kein Frühstück. Keine warme Jacke. Kein Zugang zu medizinischer Hilfe.
- Veränderung der Wahrnehmung: Wenn die Gefühle oder Erlebnisse eines Kindes infrage gestellt, geleugnet oder verdreht werden, sodass das Kind an seiner eigenen Wahrnehmung und Realität zu zweifeln beginnt. Etwa durch Aussagen wie „Das hast du dir nur eingebildet“, „So war das doch nicht“ oder „Du übertreibst“.
Wer kann subtile Gewalt ausüben?
Subtile Gewalt können nicht nur Erwachsene ausüben, sondern auch Kinder
-
Erwachsene wie Eltern, Lehrer*inne, Erzieher*innen und Pädagog*innen können bewusst oder unbewusst subtile Gewalt zeigen. Manchmal wissen sie gar nicht, wie sehr ihre Worte oder Handlungen verletzen.
-
Kinder und Jugendliche können sich auch gegenseitig verletzen, ohne es böse zu meinen. Sie testen Grenzen, sind unsicher oder verstehen nicht immer, wie ihr Verhalten ankommt.
Auch gibt es Situationen, in denen Verhalten nicht aus einer bewussten Entscheidung heraus geschieht. In denen ein Kind nicht anders kann, weil etwas in ihm zu schnell, zu laut, zu viel wird. Vielleicht fehlen die Worte, vielleicht die Regulation, vielleicht ist da einfach nur ein Impuls, der durch den Körper fährt, bevor das Bewusstsein hinterherkommt.
Und doch: Für das andere Kind bleibt ein Moment zurück, der sich nicht richtig anfühlt, und der tief wirkt. So als wäre eine Grenze überschritten worden, ohne dass es sich wehren konnte.
Hier geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Schutz, darum, dass ein Verhalten, auch wenn es erklärbar ist, nicht einfach hingenommen wird.
Denn wenn wir nur dort hinschauen, wo etwas absichtlich geschieht, übersehen wir all die kleinen, leisen Grenzverletzungen, die genauso wehtun.
Die täglichen Sticheleien. Das Auslachen. Das Ignorieren.
Nicht immer mit Absicht. Aber immer mit Wirkung.
Subtile Gewalt passiert also nicht nur mit Absicht, sondern oft auch aus Unachtsamkeit oder weil niemand genau hinschaut.
Für Maria Montessori war die Würde des Kindes unantastbar – nicht erst, wenn ein Gesetz oder Begriff sie schützt, sondern vom ersten Moment an.
Wenn wir den Mut haben, subtile Gewalt offen beim Namen zu nennen
Vielleicht liegt genau hier das Problem: Weil wir lieber auf eine klare Definition warten, statt hinzusehen, was längst spürbar ist. So, als würde das Wort „Gewalt“ erst dann zählen, wenn es ganz sicher ist und bis dahin bleibt das Kind mit seinem Schmerz allein.
Doch das Benennen ist kein Urteil, es ist ein Schritt und eine Möglichkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Es braucht Mut, das auszusprechen. Und ja, es ist unbequem, es laut auszusprechen.
Es bedeutet nämlich Selbstverständliches zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen und es bedeutet, nicht nur auf die Absicht zu schauen, sondern auf die Wirkung. Das ist ein Punkt, an dem wir als Erwachsene besonders wach sein müssen. Denn ein Verhalten mag erklärbar sein, aber das bedeutet nicht, dass es keine Wunden hinterlässt.
Wenn wir nicht benennen, was geschieht, dann passiert genau das … dann geben wir der Gewalt einen Platz im Normalen.
Und wenn wir Kindern beibringen, dass ihre Erfahrungen erst dann Bedeutung haben, wenn sie sich beweisen lassen, wenn sie laut genug sind oder eindeutig falsch, dann verlieren wir den Schutzraum, den Beziehung eigentlich bieten soll.
Warum Montessoris Fokus auf die innere Welt des Kindes den Begriff „Gewalt“ neu definiert
Maria Montessori hat Gewalt nicht nur an sichtbaren Taten oder äußerlichen Handlungen gemessen, sondern vor allem an der Erschütterung der seelischen Ordnung eines Kindes.
Für sie stand das innere Gleichgewicht, die Würde und das emotionale Wohl des Kindes im Mittelpunkt.
Jede Form von Gewalt, die diese empfindliche Balance stört, war für sie ein Grund zum Handeln, ganz gleich, ob sie laut oder leise, sichtbar oder verborgen war.
Gewalt beginnt für Montessori bereits in dem Moment, in dem das Vertrauen des Kindes in sich selbst erschüttert wird, mit dem ersten Riss, lange bevor sich das „Ich bin genug“ in ein „Mit mir stimmt etwas nicht“ verwandelt.
Besonders wichtig ist dabei, die Feinfühligkeit der Kinder von Anfang an zu achten und zu bewahren.
Kinder, die wahrnehmen, wenn Grenzen überschritten werden, dürfen nicht vorschnell als „zu empfindlich“ abgestempelt werden. Denn sie sind es nicht. Sie übertreiben auch nicht. Sie wurden nur noch nicht vom Leben so erschüttert, dass sie Gewalt in welcher Form auch immer bereits als normal abgestempelt haben. Ihre Sensibilität zeigt genau hier ein gesundes Gespür für Respekt und Achtung!
Wenn es also gelingt, in einer Umgebung aufzuwachsen, in der keine oder möglichst wenig Gewalt – auch in ihren subtilen Formen – passiert, kann sich diese Feinfühligkeit zu einer wertvollen Stärke werden.
Diese Sensibilität ist ein zentraler Bestandteil der Friedenserziehung, die Maria Montessori so wichtig war.
Maria Montessori erkannte früh, dass es eben nicht genügt, allein akute Gewalt oder bestehende Konflikte zu bekämpfen. Solche Maßnahmen sind wichtig, greifen jedoch oft zu kurz, weil sie erst dann ansetzen, wenn Schaden bereits entstanden ist.
Für eine tiefgreifende und nachhaltige Veränderung ist es wichtig, bereits viel früher anzusetzen. Und genau dieses feine Gespür für das Innenleben der Kinder ist es, worauf wir heute neu achten sollten, wenn wir wirklich verstehen und schützen wollen.

Montessori und Mut zum Hinschauen
Montessori-Pädagogik bedeutet weit mehr als nur den Umgang mit tollem Montessori-Material oder das Verstehen von Grammatik und mathematischen Formeln über das Begreifen.
Genau deshalb ist die Montessori-Pädagogik für mich so besonders und genau deshalb fühle ich mich zu ihr hingezogen.
Montessori und Mut zum Hinschauen
Montessori-Pädagogik bedeutet weit mehr als nur den Umgang mit tollem Montessori-Material oder das Verstehen von Grammatik und mathematischen Formeln über das Begreifen.
Genau deshalb ist die Montessori-Pädagogik für mich so besonders und genau deshalb fühle ich mich zu ihr hingezogen.

Es gibt Werte in mir, die sind so tief verwurzelt, dass ich gar nicht anders kann, als für sie zu kämpfen. Nicht, weil sie nur schön klingen, sondern weil sie Teil dessen sind, wer ich wirklich bin. Wegsehen würde wie ein schwerer Stein auf meiner Brust liegen, es wäre wie ein ständiges Ziehen in meinem Bauch. Die Augen zu verschließen wäre, als würde ich ein Teil von mir selbst verraten, als würde ich die leisen Schreie der Kinder in mir ertränken.
Montessori-Pädagogik heißt für mich, diese Werte eben nicht nur zu kennen, sondern sie auch zu leben: offen, ehrlich und konsequent.
Es ist die Achtung vor jedem Menschen, die Bereitschaft zuzuhören, die Liebe zum Kind in all seiner Verletzlichkeit und Kraft. Sie sind mein Kompass in einer Welt, die oft oberflächlich ist und zu schnell urteilt.
Ich mag nicht die ganze Welt verändern können.
Aber ich kann hier bei mir beginnen, bei meinen Kindern, in meinem Umfeld und vielleicht auch bei dir, als Leser*in des Montessori-Blogs.
Deshalb habe ich diese Zeilen geschrieben, aus tiefer Überzeugung und dem Wunsch, dass wir alle mutiger hinschauen.
Genau dort liegt der Anfang von wirklicher Veränderung.
Maria Montessori - "Die neue Erziehung ist eine Revolution ohne Gewalt"
© Montessori-Online, Juni 2025 · Geschrieben von Birgit Salvenmoser
dipl. Montessori-Pädagogin
(Montessori-Akademie | ÖMG)
Weitere Artikel und Angebote, die dich interessieren könnten:
Montessori lernen:
Wenn du tiefer in die Montessori-Pädagogik einsteigen möchtest, schau dir den Montessori-Grundlagen Online-Kurs an – ideal für Eltern, Erzieher*innen und alle, die die Montessori-Pädagogik verstehen wollen.